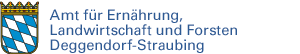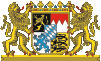Praxisunterricht der Erstsemester der Landwirtschaftsschule
Zwischenfruchtanbau im Fokus
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
© Dr. Anita Lehner-Hilmer
Für Unterricht zum Thema Zwischenfruchtanbau wurde im Herbst 2025 die Fläche bewusst gewählt, da sie sich im Wasserschutzgebiet befindet und Stickstoff, der nicht in Pflanzenmasse gebunden sondern ausgewaschen wird, das Grundwasser belasten kann. Angebaut wurden drei unterschiedliche Zwischenfruchtmischungen zum Vergleich: eine Mischung, sowie je eine Parzelle Ölrettich und Erbsen. Ziel des Versuches ist es herauszufinden, welche Mengen an Stickstoff nach der Zwischenfrucht noch im Boden sind und den Nachfolgefrüchten zur Verfügung stehen.
Vor- und Nachteile einzelner Zwischenfrüchte
Anglsperger informierte über die Schaufläche sowie die Vorteile und Herausforderungen der einzelnen Zwischenfrüchte. Ölrettich lockert durch seine tiefen Pfahlwurzeln den Boden und erschließt Nährstoffe aus tieferen Schichten, hieß es. Zudem trägt er zum Gewässerschutz bei, da er Stickstoff bindet. Allerdings besteht die Gefahr der Überwinterung, wenn die Samenbildung bereits beginnt. „Erbsen, eine Leguminose, bringen Stickstoff in den Boden, fördern die Bodenfruchtbarkeit und unterdrücken Unkraut, sind jedoch in Wasserschutzgebieten vorsichtig zu verwenden und haben höhere Saatkosten“, erklärte Anglsperger. Die Mischung vereint die Vorteile kleinkörniger Leguminosen und Nicht-Leguminosen, sorgt für eine stabile Bodenbedeckung und fördert den Humusaufbau, ist aber manchmal in der Entwicklung der einzelnen Pflanzenpartner eingeschränkt.
Bodenbeurteilung ist das A und O
Anton Maier, klärte über wirtschliche Aspekte auf und widmete sich dem Boden. Die Studierenden lernten, den Zustand des Bodens zu beurteilen, indem sie die Struktur der Oberfläche, die Durchwurzelung, die Porenbildung sowie Ernterückstände und Bodenfarbe untersuchten. Dabei wurden praktische Techniken wie die Spatenprobe demonstriert, mit der die Schüler den Boden auf Wurzeln, Poren und Festigkeit untersuchten. „Diese Kenntnisse sind essenziell, um die richtige Bewirtschaftung und Fruchtfolgeplanung zu gewährleisten“, sagte Maier.
Bodenprobe zur Analyse
Abschließend zogen die Studierenden Bodenproben in 30 und 60 Zentimeter Tiefe zur exakten Analyse des verfügbaren mineralisierten Stickstoffs. Diese Untersuchung hilft, die Fixierungsleistung der Zwischenfrüchte besser zu verstehen und die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig zu verbessern. Versehen mit dem notwendigen theoretischen Wissen, sammelten die Studierenden umfassende praktische Erfahrungen, die sie auf künftige landwirtschaftliche Herausforderungen vorbereitet.