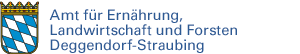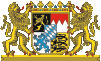Landwirtschaft und Artenschutz am Beispiel Kiebitz
Feldvögel und Wiesenbrüter schützen
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
H.-J. Fünfstück/www.5erls-naturfotos.de
Der Gelegeschutz für Feldvögel und Wiesenbrüter trägt zum Artenschutz bei. Auf Feldstücken in den entsprechenden Gebietskulissen für Feldvogel und Wiesenbrüter ist der Gelegeschutz zu beachten.
Kiebitze bevorzugen offene Flächen mit niedriger Vegetation und Offenboden, die durch hohe Wasserstände besonders feucht sind. Sie brüten daher oft in Ackerflächen.
Gelege schützen
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Kiebitznest im Feld
Die Gülleausbringung in der Feldvogel- und Wiesenbrüterkulisse sollte erst bei einer Bestandshöhe des Maises von 35- 50 cm durchgeführt werden. Somit wären Verluste in der Brut -und Aufzuchtzeit deutlich entschärft.
Kulisse der Wiesenbrütergebiete (Fachinformationssystem FiN-Web) selbst abrufen ![]()
Kiebitz: Steckbrief
- Zwischen 1992 und 2016 sind die Kiebitzbestände in Deutschland um 88 Prozent zurückgegangen.
- Der Kiebitz steht auf der roten Liste Kategorie 2: Stark gefährdet.
- Er ruft seinen Namen "Ki-witt".
- Männliche Kiebitze unterscheiden sich zur Brutzeit von den Weibchen durch eine längere Federholle am Kopf, eine komplett schwarz gefärbte Brust (Weibchen haben meist eingestreute weiße Federn) sowie eine hellere Gesichtsfärbung.
- Kiebitze bevorzugen offene Flächen mit niedriger Vegetation und Offenboden, die durch hohe Wasserstände besonders feucht sind. Sie brüten daher oft in Ackerflächen.
- Kiebitze haben es gerne übersichtlich und meiden Gehölzstrukturen und andere Sichtbarrieren.
- Sie sind oft sehr standorttreu und nutzen traditionelle Brutstandorte immer wieder.
- Hauptnahrung der Altvögel sind Bodenorganismen, z.B. Regenwürmer. Küken jagen vor allem Spinnen und andere Wirbellose auf dem Boden.
- Insbesondere die Männchen der Kiebitze verteidigen ihre Reviere und vollführen im Frühjahr beeindruckende Balzflüge. Geeignete Flächen werden von mehreren Paaren in lockeren Kolonien besiedelt.
- Das Nest ist eine Mulde am Boden mit meist vier Eiern. Die durchschnittliche Brutzeit beträgt etwa 28 Tage.
- Die Jungen sind Nestflüchter und verlassen das Nest kurz nach dem Schlupf. Mit etwa vier Wochen sind sie flugfähig.
- Die Brutzeit beginnt je nach Witterung bereits ab Mitte März. Bei Verlust des Nests legen die Kiebitze ein Nachgelege an.
- Somit erstreckt sich die Aufzuchtzeit der Brut und Jungvögel von Mitte März bis etwa Mitte Juni.
- Um den Bestand stabil zu halten, ist ein Bruterfolg von rund 0,8 bis 0,9 flüggen Jungvögeln pro Brutpaar und Jahr nötig. Dies wird bei uns in den wenigsten Brutgebieten erreicht.
Weitere Informationen und Quellen
Ansprechpartner LPV:
Adrian Wimmer, Landschaftsökologe
Öko- und Ausgleichsflächen, Wiesenbrüterschutz
Tel.: 08721-5089357 (Mo.-Do.)
E-Mail: adrian.wimmer@lpv.rottal-inn.de
Internet: Ansprechpartner des LPV ![]()
Video
Aktivierung erforderlich
Durch das Klicken auf diesen Text werden in Zukunft YouTube-Videos im gesamten Internetauftritt eingeblendet.Aus Datenschutzgründen weisen wir darauf hin, dass nach der dauerhaften Aktivierung Daten an YouTube übermittelt werden.
Auf unserer Seite zum Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen und können diese Aktivierung wieder rückgängig machen.